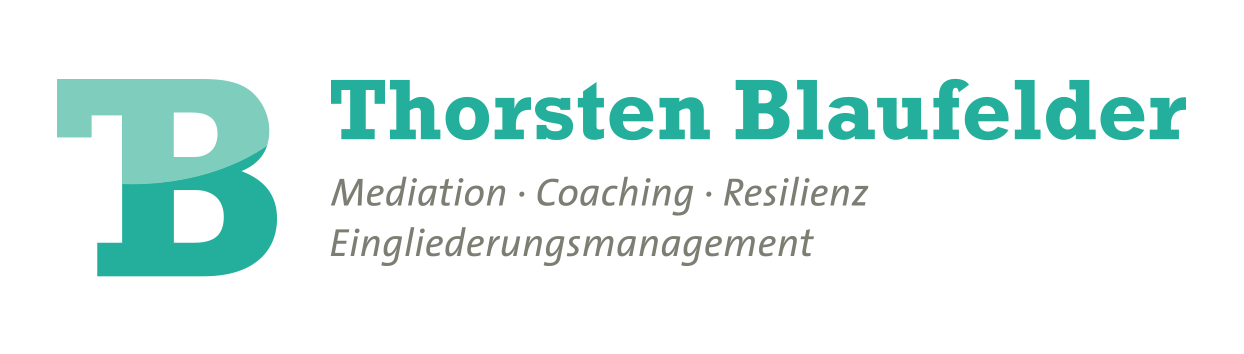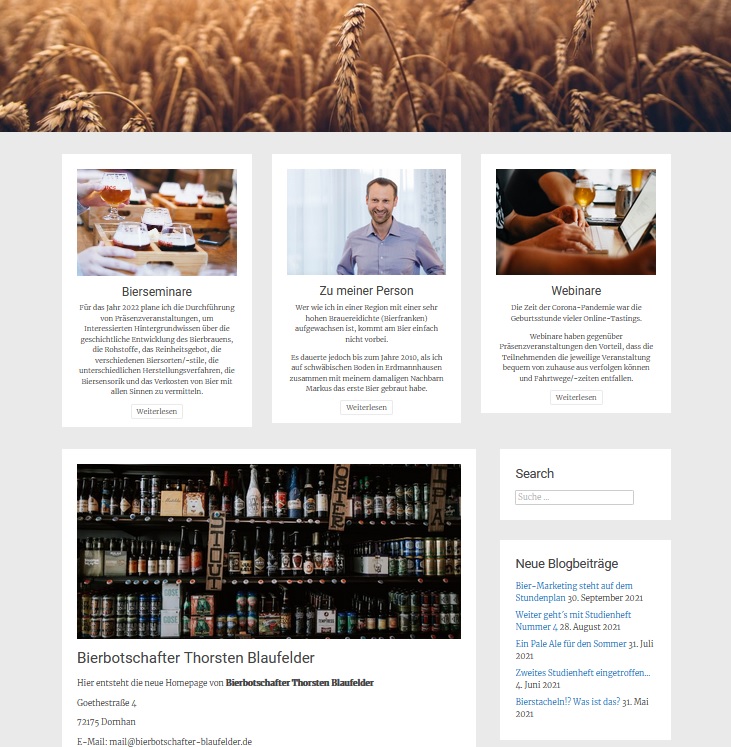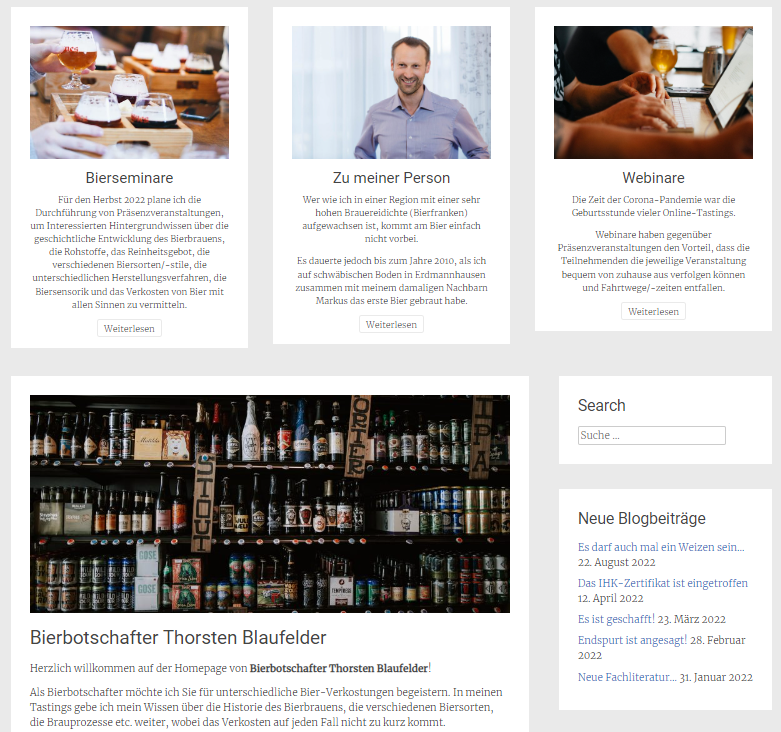19. Juli 2024
In der modernen Arbeitswelt spielt die Führung eine zentrale Rolle, nicht nur für die Leistung und Zufriedenheit der Mitarbeitenden, sondern auch für deren Gesundheit und Wohlbefinden. Doch was zeichnet gute Führung aus und welche Auswirkungen hat sie auf die Gesundheit der Beschäftigten?
Was ist gute Führung?
Gute und konstruktive Führung kann durch drei Hauptkomponenten charakterisiert werden: Aufgabenorientierung, Beziehungsorientierung und Veränderungsorientierung.
- Aufgabenorientierung: Hierbei stehen die klaren Rollenerwartungen und Aufgabenstellungen im Vordergrund. Führungskräfte, die ihre Mitarbeitenden gut führen, planen und strukturieren die Arbeit, überwachen den Fortschritt und beseitigen Hindernisse. Diese Art der Führung reduziert Unsicherheiten und sorgt für eine reibungslose Zusammenarbeit.
- Beziehungsorientierung: Diese Führungskräfte begegnen ihren Mitarbeitenden auf Augenhöhe und verstehen sich als Partner. Durch Unterstützung, Wertschätzung und gegenseitiges Vertrauen wird eine positive Arbeitsatmosphäre geschaffen. Dies fördert die Selbstständigkeit und die persönliche Weiterentwicklung der Mitarbeitenden.
- Veränderungsorientierung: Hierbei geht es um den Blick in die Zukunft und das gemeinsame Erarbeiten von Zielen. Führungskräfte, die diesen Ansatz verfolgen, inspirieren ihre Mitarbeitenden und sind Innovationen gegenüber offen. Dies fördert die Lernbereitschaft und das persönliche Wachstum der Mitarbeitenden.
Auswirkungen auf die Gesundheit
Wissenschaftliche Studien, wie eine kürzlich veröffentlichte Meta-Studie mit Daten von fast 100.000 Mitarbeitenden, zeigen, dass gute und konstruktive Führung positiv mit der Gesundheit der Beschäftigten zusammenhängt. Im Gegensatz dazu kann destruktive Führung, wie feindseliges Verhalten oder mangelnde Unterstützung, erhebliche negative Auswirkungen haben, darunter depressive Symptome, Schlafstörungen und Burnout.
Destruktive Führung: Ein Gesundheitsrisiko
Destruktive Führung ist ein Stressfaktor, der erhebliche gesundheitliche Probleme verursachen kann. Führungskräfte, die ihre Mitarbeitenden respektlos behandeln, kein Feedback geben oder sich nicht an Absprachen halten, erhöhen die Belastung und führen zu einem schlechten Arbeitsklima. Besonders problematisch ist die “Laissez-Faire”-Führung, bei der Führungskräfte sich aus ihrer Rolle zurückziehen und Entscheidungen aufschieben.
Gesundheitsorientierte Führung
Moderne Ansätze betonen auch die Gesundheitsorientierung der Führungskräfte selbst. Führungskräfte sollten ein Vorbild im Umgang mit ihrer eigenen Gesundheit sein. Studien zeigen, dass das Verhalten der Führungskraft sich auf die Mitarbeitenden überträgt. Eine Führungskraft, die auf ihre eigene Erholung und Gesundheit achtet, fördert ein gesundes Arbeitsumfeld und motiviert die Mitarbeitenden zu ähnlichem Verhalten.
Maßnahmen zur Förderung guter Führung
Organisationen sollten verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen kombinieren, um gute Führung zu fördern. Dies beginnt bei der sorgfältigen Auswahl von Führungskräften und der kontinuierlichen Weiterbildung. Führungskräfte sollten nicht nur fachlich kompetent, sondern auch in der Lage sein, unterstützend und motivierend zu führen.
Fazit
Gute und konstruktive Führung ist entscheidend für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden. Organisationen sollten ein ganzheitliches Verständnis von guter Führung entwickeln und sicherstellen, dass Führungskräfte die notwendigen Ressourcen und Unterstützung erhalten. Nur so kann ein gesundes und produktives Arbeitsumfeld geschaffen werden, das sowohl den Mitarbeitenden als auch der Organisation zugutekommt.
Besuchen Sie www.gesunde-arbeitskultur.jetzt, um mehr über die Förderung einer gesunden Arbeitskultur in Ihrem Unternehmen zu erfahren und wie Sie durch gute Führung das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeitenden steigern können.

Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.
Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.
Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Warum nicht mal Mediation probieren?
Vielleicht sollten es Streitparteien öfters mal mit Mediation versuchen. Ziel einer Mediation ist eine “win-win”-Lösung, bei der am Ende beide Streitparteien als Gewinner hervorgehen und eine eventuell langjährige Geschäftsbeziehung wertschätzend fortgesetzt werden kann.

In puncto gesunder Arbeitskultur bin ich deutschlandweit, insbesondere in Baden-Württemberg tätig, vor allem aber in den Orten Dornhan, Rottweil, Horb am Neckar, Villingen-Schwenningen, Nagold, Oberndorf am Neckar, Altensteig, Sulz am Neckar, Schramberg, Dunningen, Eutingen im Gäu, Empfingen, Fluorn-Winzeln, Waldachtal, Starzach, Pfalzgrafenweiler, Balingen, Haigerloch, Bondorf, Mössingen, Trossingen.

18. Juli 2024
Die Pandemie hat den Fokus auf Gesundheitsschutz und betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) erheblich verstärkt. Die Arbeitgeber waren gezwungen, Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen und Maßnahmen zur Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu ergreifen. Diese Notwendigkeit hat das Bewusstsein für die Bedeutung des BGM geschärft.
Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es noch viel zu tun ist. Viele Arbeitgeber sehen ihre Pflichten im Bereich Gesundheitsschutz eher als bürokratische Pflicht denn als ernsthafte Aufgabe. Oftmals werden Maßnahmen nur halbherzig umgesetzt, und die Beschäftigten bleiben als Experten in eigener Sache ungehört.
Die Herausforderungen im BGM
Ein zentrales Problem ist das Führungsverhalten der Vorgesetzten. Viele Arbeitgeber zögern, Veränderungen in ihrem Leitungskader vorzunehmen, was die Umsetzung von BGM-Maßnahmen erschwert. Ein weiteres Hindernis ist der Personalmangel. Die Arbeitsverdichtung ist hoch, und Betriebs- und Personalräte kämpfen darum, die notwendigen Verbesserungen durchzusetzen.
Gesundheitsschutz und Fachkräftemangel
In Zeiten des Fachkräftemangels gewinnt die Gesundheit der Beschäftigten an Bedeutung. Verwaltungen und Betriebe erkennen zunehmend, dass gute Arbeitsschutzmaßnahmen und Gesundheitsförderung die Mitarbeiterbindung stärken. Doch die Umsetzung ist oft mangelhaft, und es fehlt an wirksamen Maßnahmen wie zusätzlichem Personal, besseren Arbeitsmitteln und einer positiven Betriebskultur.
Erfolgsfaktoren für ein nachhaltiges BGM
Eine nachhaltige Umsetzung des BGM erfordert die kontinuierliche Einbindung der Beschäftigten. Diese sollten aktiv an der Gefährdungsbeurteilung beteiligt werden, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und die Zufriedenheit zu erhöhen. Zusätzlich ist eine strategisch gut organisierte Führungsebene entscheidend, um humane Arbeitsbedingungen und realistische Anforderungen zu gewährleisten.
Fazit
BGM ist ein ganzheitlicher Ansatz, der die Arbeitsbedingungen und -organisation gesundheitsförderlich gestalten soll. Die Pandemie hat gezeigt, dass es möglich ist, den Gesundheitsschutz in den Mittelpunkt zu rücken. Nun gilt es, diese Erkenntnisse nachhaltig umzusetzen und die Arbeitsqualität stetig zu verbessern. Nur so können Unternehmen ihre Beschäftigten langfristig unterstützen und gleichzeitig ihre Attraktivität als Arbeitgeber erhöhen.
Erfahren Sie, wie Sie die Gesundheit und Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter fördern können. Verschaffen Sie sich einen Überblick meiner Angebote auf www.gesunde-arbeitskultur.jetzt und starten Sie noch heute mit einem nachhaltigen Gesundheitsmanagement in Ihrem Unternehmen!

Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.
Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.
Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Warum nicht mal Mediation probieren?
Vielleicht sollten es Streitparteien öfters mal mit Mediation versuchen. Ziel einer Mediation ist eine “win-win”-Lösung, bei der am Ende beide Streitparteien als Gewinner hervorgehen und eine eventuell langjährige Geschäftsbeziehung wertschätzend fortgesetzt werden kann.

In puncto gesunder Arbeitskultur bin ich deutschlandweit, insbesondere in Baden-Württemberg tätig, vor allem aber in den Orten Dornhan, Rottweil, Horb am Neckar, Villingen-Schwenningen, Nagold, Oberndorf am Neckar, Altensteig, Sulz am Neckar, Schramberg, Dunningen, Eutingen im Gäu, Empfingen, Fluorn-Winzeln, Waldachtal, Starzach, Pfalzgrafenweiler, Balingen, Haigerloch, Bondorf, Mössingen, Trossingen.

16. Juli 2024
Die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst stehen zunehmend im Fokus. Eine Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit 2023 zeigt, dass es in diesem Bereich dringenden Handlungsbedarf gibt. Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse aus der Analyse:
- Hohe Arbeitsintensität: Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst berichten von einer hohen Arbeitsintensität. Fast die Hälfte (45%) gibt an, häufig wegen Personalmangels mehr arbeiten zu müssen. Zudem müssen 41% der Befragten mehr Arbeit in der gleichen Zeit erledigen als zuvor.
- Atypische Arbeitszeiten: Viele Beschäftigte im öffentlichen Dienst arbeiten zu untypischen Zeiten wie abends, nachts oder an Wochenenden. Dies betrifft fast ein Drittel der Beschäftigten. Solche Arbeitszeiten können die Regeneration stören und wirken sich negativ auf die Gesundheit aus.
- Selbsteinschätzung der Gesundheit: Die gesundheitliche Selbsteinschätzung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist gemischt. Während 59% ihren Gesundheitszustand als gut oder sehr gut beschreiben, beurteilen 41% ihre Gesundheit als zufriedenstellend, weniger gut oder schlecht.
- Mangelnde Präventionsmaßnahmen: Viele Arbeitgeber im öffentlichen Dienst ergreifen nicht ausreichend Maßnahmen zur Prävention. Nur 42% der Beschäftigten berichten, dass in den letzten zwei Jahren eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt wurde. Psychische Belastungen werden dabei oft vernachlässigt.
- Zeit- und Termindruck: Zeit- und Termindruck sind weit verbreitete Belastungsfaktoren. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten (54%) fühlt sich bei der Arbeit häufig gehetzt.
- Fehlende Ressourcen: Ein weiteres großes Problem ist der Mangel an Ressourcen. Beschäftigten fehlen oft die notwendigen Mittel, um ihre Arbeit gut zu erledigen, was die Arbeitsqualität beeinträchtigt.
Empfehlungen zur Verbesserung:
- Mehr Personal und bessere Ressourcen: Der Einsatz von mehr Personal und die Bereitstellung ausreichender Ressourcen könnten die Arbeitsbelastung senken und die Qualität der Arbeit verbessern.
- Gefährdungsbeurteilungen: Regelmäßige und vollständige Gefährdungsbeurteilungen, die auch psychische Belastungen berücksichtigen, sind notwendig.
- Flexiblere Arbeitszeiten: Flexiblere und familienfreundlichere Arbeitszeiten könnten die Regeneration der Beschäftigten unterstützen.
- Erholungs- und Gestaltungsfreiräume: Beschäftigte sollten mehr Autonomie und Gestaltungsspielräume in ihrer Arbeit haben, um die Arbeitsintensität zu verringern und die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen.
Die Ergebnisse der Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit zeigen klar, dass im öffentlichen Dienst Handlungsbedarf besteht. Es bedarf umfassender Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Prävention von Gesundheitsbelastungen, um eine langfristig gesunde und motivierte Belegschaft zu gewährleisten.
Optimieren Sie Ihre Arbeitskultur
Möchten Sie die Arbeitsbedingungen in Ihrem Unternehmen nachhaltig verbessern und eine gesunde Arbeitskultur fördern? Entdecken Sie unsere umfassenden Angebote zur Prävention und Optimierung der Arbeitsbedingungen. Gemeinsam schaffen wir ein Umfeld, in dem Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund, motiviert und produktiv arbeiten können. Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung!

Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.
Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.
Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Warum nicht mal Mediation probieren?
Vielleicht sollten es Streitparteien öfters mal mit Mediation versuchen. Ziel einer Mediation ist eine “win-win”-Lösung, bei der am Ende beide Streitparteien als Gewinner hervorgehen und eine eventuell langjährige Geschäftsbeziehung wertschätzend fortgesetzt werden kann.

In puncto gesunder Arbeitskultur bin ich deutschlandweit, insbesondere in Baden-Württemberg tätig, vor allem aber in den Orten Dornhan, Rottweil, Horb am Neckar, Villingen-Schwenningen, Nagold, Oberndorf am Neckar, Altensteig, Sulz am Neckar, Schramberg, Dunningen, Eutingen im Gäu, Empfingen, Fluorn-Winzeln, Waldachtal, Starzach, Pfalzgrafenweiler, Balingen, Haigerloch, Bondorf, Mössingen, Trossingen.

21. März 2024
Mein Fachartikel “Ganzheitliche Gefährdungsbeurteilung: psychische Gesundheit in Unternehmen” ist in der März-Ausgabe der Fachzeitschrift Betriebliche Prävention – Arbeit | Gesundheit | Unfallversicherung – www.BePrdigital.de – erschienen.
An dieser Stelle kann der Beitrag auch heruntergeladen werden.
In puncto gesunder Arbeitskultur bin ich deutschlandweit, insbesondere in Baden-Württemberg tätig, vor allem aber in den Orten Dornhan, Rottweil, Horb am Neckar, Villingen-Schwenningen, Nagold, Oberndorf am Neckar, Altensteig, Sulz am Neckar, Schramberg, Dunningen, Eutingen im Gäu, Empfingen, Fluorn-Winzeln, Waldachtal, Starzach, Pfalzgrafenweiler, Balingen, Haigerloch, Bondorf, Mössingen, Trossingen.
Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.
Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.
Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Warum nicht mal Mediation probieren?
Vielleicht sollten es Streitparteien öfters mal mit Mediation versuchen. Ziel einer Mediation ist eine “win-win”-Lösung, bei der am Ende beide Streitparteien als Gewinner hervorgehen und eine eventuell langjährige Geschäftsbeziehung wertschätzend fortgesetzt werden kann.