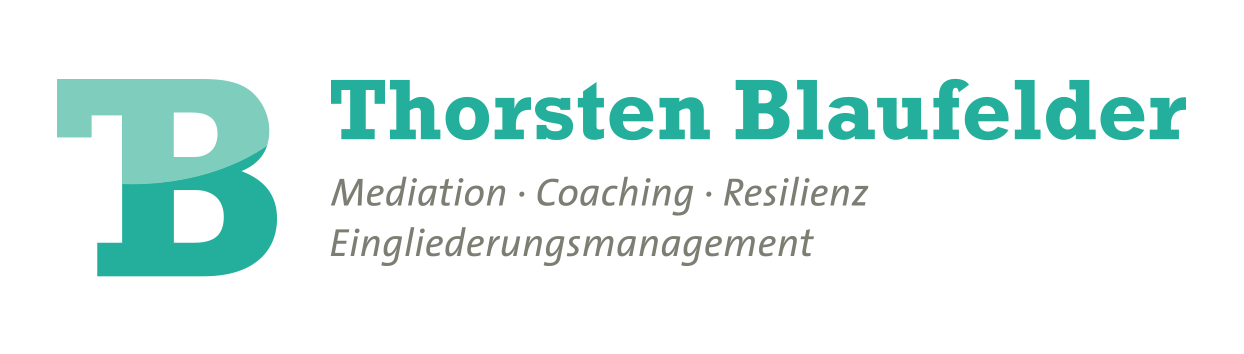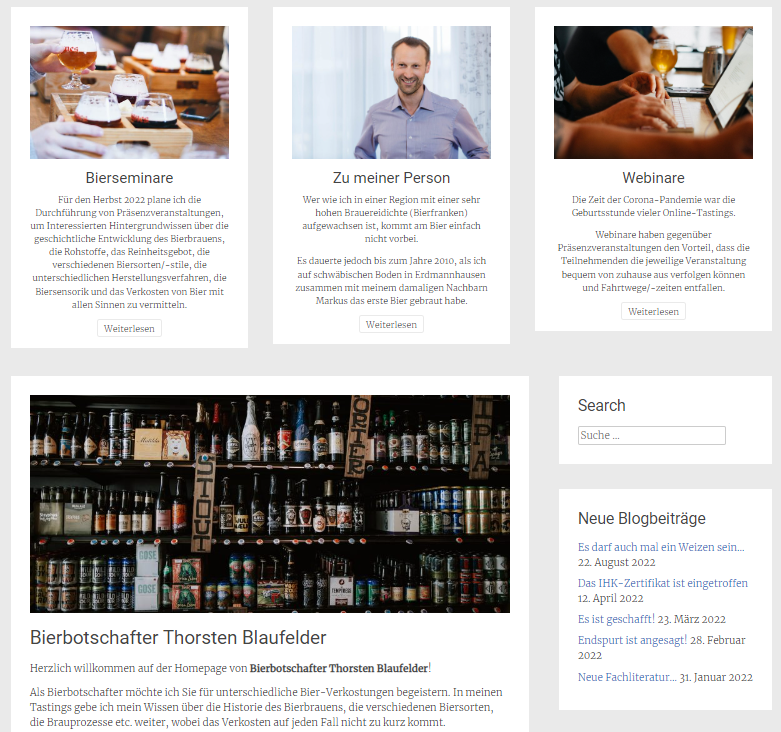1. Mai 2023
Ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (kurz: BEM) muss der Arbeitgeber für Mitarbeiter anbieten, die über einen längeren Zeitraum arbeitsunfähig erkrankt sind.
Beim BEM handelt es sich nicht um ein einmaliges Gespräch, sondern um ein ergebnisoffenes Verfahren.
Dessen Ziel ist es, Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz des betroffenen Beschäftigten zu erhalten.
Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Durchführung eines BEM ist seit Mai 2004 im Sozialgesetzbuch IX (kurz: SGB IX) geregelt. Dennoch ist dieses Verfahren vor allem in vielen kleinen Unternehmen noch Neuland, obwohl die Durchführung in § 167 Abs. 2 SGB IX für alle privaten und öffentlichen Arbeitgeber unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten zwingend vorgeschrieben ist.
Hier geht es zum 1. Teil, 2. Teil und 3. Teil der Artikel-Serie.
5. Erstkontakt mit dem Betroffenen
Wenn der Sechs-Wochen-Zeitraum überschritten ist, muss der Arbeitgeber Kontakt mit dem betroffenen Mitarbeiter aufnehmen. Die wichtigste Zielsetzung beim Herstellen des Erstkontakts besteht darin, dem Arbeitnehmer die positive Aufmerksamkeit des Betriebs zu signalisieren und Vertrauen aufzubauen. Die Frage, ob ein BEM überhaupt und mit welchem Erfolg durchgeführt wird, ist entscheidend von der Zustimmung und der Kooperationsbereitschaft des Mitarbeiters abhängig. Daher ist es besonders wichtig, dass die Kontaktaufnahme mit der betroffenen Person behutsam und mit der erforderlichen Wertschätzung erfolgt. Viele Arbeitnehmer sind durch die in der Vergangenheit häufig geübte Praxis der oben angesprochenen Krankenrückkehrgespräche verunsichert und fürchten den Verlust ihres Arbeitsplatzes.
Im Erstkontakt wird der Arbeitnehmer auf die Freiwilligkeit der Teilnahme am BEM hingewiesen. Ihm ist zu verdeutlichen, dass er nicht verpflichtet ist, die Diagnosen seiner Erkrankung zu nennen. Diese sind nicht erforderlich, sondern nur die gesundheitlichen Daten und Angaben, die zur Beurteilung der Ursachen der Arbeitsunfähigkeit und der gesundheitlichen Einschränkung der Einsatzmöglichkeiten des Arbeitnehmers notwendig sind.
Die Art und Weise des Erstkontakts hängt von den Umständen des Einzelfalles und den betrieblichen Rahmenbedingungen ab; grundsätzlich bietet sich ein Informationsschreiben an, welches durch eine persönliche Ansprache ergänzt werden sollte. Wird ein Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz aufgesucht, sollte dies so diskret geschehen, dass dabei die Vertraulichkeit gewahrt wird. Zeigt der Arbeitnehmer Bereitschaft für ein kurzes Gespräch, sollte dazu die Örtlichkeit so gewählt werden, dass es dabei zu keiner Störung kommt. Der Erstkontakt kann telefonisch erfolgen, wenn der Beschäftigte wegen der Arbeitsunfähigkeit nicht im Betrieb ist. Ein erstes Telefonat kann zwar persönlicher sein als ein Brief. Andererseits muss bedacht werden, dass sich der Betroffene durch ein unangekündigtes Telefonat „überrumpelt“ fühlen könnte. Entscheidet sich der Betrieb dafür, mit dem Arbeitnehmer nur schriftlich Kontakt aufzunehmen, sollte darauf geachtet werden, dass das Schreiben wohlwollend formuliert ist und der Mitarbeiter sich in keiner Weise unter Druck gesetzt fühlt.
Der Beitrag wird bald fortgesetzt mit Teil 5.
Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.
Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.
Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Beratung im kollektiven Arbeitsrecht notwendig?
Falls Sie eine arbeitsrechtliche Beratung im kollektiven Arbeitsrecht benötigen, rufen Sie mich umgehend an.

Mein XING-Profil finden Sie hier. Auf LinkedIn ist mein Profi dort zu finden.

27. April 2023
Urlaub ist eine großartige Möglichkeit, um dem täglichen Stress und den Belastungen zu entfliehen und sich zu erholen. Doch nicht nur das – Urlaub kann auch dazu beitragen, die eigene Resilienz zu erhöhen. Nachfolgend werden einige Möglichkeiten aufgezeigt, wie Urlaub dazu beitragen kann, die Resilienz zu steigern.
- Abstand vom Alltag gewinnen: Urlaub gibt uns die Möglichkeit, uns von unserem Alltag und den damit verbundenen Belastungen und Stressoren zu distanzieren. Dies kann uns helfen, uns zu erholen und neue Energie zu tanken. Durch diese Pause vom Alltag können wir auch unsere Perspektive verändern und neue Lösungsansätze finden, um Herausforderungen besser zu bewältigen.
- Zeit für Selbstfürsorge nehmen: Urlaub kann uns die Möglichkeit geben, Zeit für uns selbst und unsere Bedürfnisse zu nehmen. Indem wir uns auf uns selbst konzentrieren und uns um unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden kümmern, können wir unsere Resilienz stärken. Zum Beispiel können wir uns Zeit nehmen, um zu meditieren, Yoga zu praktizieren oder uns mit gesunder Ernährung und ausreichend Schlaf zu versorgen.
- Neue Erfahrungen sammeln: Urlaub gibt uns die Chance, neue Erfahrungen zu sammeln und unsere Komfortzone zu verlassen. Durch das Ausprobieren neuer Aktivitäten oder den Besuch neuer Orte können wir uns neuen Herausforderungen stellen und unsere Fähigkeit zur Anpassung und Flexibilität verbessern. Diese Erfahrungen können uns auch helfen, besser mit Unsicherheit und Veränderungen umzugehen.
- Soziale Kontakte pflegen: Urlaub kann auch dazu beitragen, unsere sozialen Kontakte zu pflegen und neue Freunde zu finden. Durch den Austausch mit anderen Menschen und das Teilen von Erfahrungen können wir unser soziales Netzwerk stärken. Dies kann uns helfen, Unterstützung in schwierigen Zeiten zu finden und uns bei der Bewältigung von Herausforderungen zu helfen.
- Die Natur genießen: Urlaub kann uns auch die Möglichkeit geben, die Natur zu genießen und uns mit ihr zu verbinden. Durch das Wandern, Schwimmen oder einfach nur Spazierengehen in der Natur können wir unseren Stress reduzieren und uns mit der Schönheit und Kraft der Natur verbinden. Diese Erfahrung kann uns helfen, unsere eigene Stärke und Widerstandsfähigkeit zu entdecken und zu stärken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Urlaub eine wunderbare Möglichkeit ist, um unsere Resilienz zu stärken. Durch den Abstand vom Alltag, die Zeit für Selbstfürsorge, das Sammeln neuer Erfahrungen, das Pflegen sozialer Kontakte und das Genießen der Natur können wir unsere Resilienz verbessern und gestärkt zurückkehren.
Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.
Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.
Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Beratung im kollektiven Arbeitsrecht notwendig?
Falls Sie eine arbeitsrechtliche Beratung im kollektiven Arbeitsrecht benötigen, rufen Sie mich umgehend an.

Mein XING-Profil finden Sie hier. Auf LinkedIn ist mein Profi dort zu finden.

26. April 2023
Körperliche Resilienz bezieht sich auf die Fähigkeit des Körpers, sich an Stressoren und Herausforderungen anzupassen und sich zu erholen. Eine starke körperliche Resilienz kann uns helfen, unsere körperliche Gesundheit und Widerstandsfähigkeit zu verbessern und unser Risiko für verschiedene Krankheiten und Verletzungen zu verringern.
Nachfolgend werden einige Tipps zur Stärkung der körperlichen Resilienz vorgestellt:
- Regelmäßige körperliche Aktivität ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Stärkung der körperlichen Resilienz. Körperliche Aktivität kann dazu beitragen, die körperliche Gesundheit zu verbessern, das Immunsystem zu stärken und das Risiko für verschiedene Krankheiten und Verletzungen zu verringern. Es ist wichtig, mindestens 30 Minuten moderate körperliche Aktivität pro Tag durchzuführen, wie zum Beispiel Spazierengehen, Radfahren oder Schwimmen.
- Eine ausgewogene Ernährung ist ebenfalls entscheidend für die Stärkung der körperlichen Resilienz. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Obst und Gemüse, Vollkornprodukten, magerem Protein und gesunden Fetten kann dazu beitragen, den Körper mit wichtigen Nährstoffen und Energie zu versorgen. Eine ausgewogene Ernährung kann auch dazu beitragen, das Immunsystem zu stärken und das Risiko für verschwiedene Krankheiten zu verringern.
- Ausreichender Schlaf ist ebenfalls wichtig für die Stärkung der körperlichen Resilienz. Der Körper benötigt ausreichend Schlaf, um sich zu erholen und zu regenerieren. Es wird empfohlen, mindestens 7-8 Stunden Schlaf pro Nacht zu bekommen, um eine optimale körperliche Gesundheit und Widerstandsfähigkeit zu erreichen.
- Stress kann einen großen Einfluss auf die körperliche Gesundheit haben und das Risiko für verschiedene Krankheiten erhöhen. Es ist wichtig, Stress effektiv zu bewältigen, um die körperliche Resilienz zu stärken. Einige Möglichkeiten zur Stressbewältigung sind beispielsweise regelmäßige Entspannungsübungen wie Yoga oder Meditation, tiefes Atmen, regelmäßige Pausen und Zeit für Hobbys und soziale Aktivitäten.
- Schädliche Verhaltensweisen wie Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum und Drogenmissbrauch können das Risiko für verschiedene Krankheiten und Verletzungen erhöhen und die körperliche Resilienz beeinträchtigen. Es ist wichtig, schädliche Verhaltensweisen zu vermeiden, um die körperliche Gesundheit zu verbessern und die körperliche Resilienz zu stärken.
Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.
Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.
Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Beratung im kollektiven Arbeitsrecht notwendig?
Falls Sie eine arbeitsrechtliche Beratung im kollektiven Arbeitsrecht benötigen, rufen Sie mich umgehend an.

Mein XING-Profil finden Sie hier. Auf LinkedIn ist mein Profi dort zu finden.

24. April 2023
Was Mediation ist, habe ich in diesem Artikel erläutert.
Aber wie läuft ein Mediationsverfahren in der Praxis ab?
Ein Mediationsverfahren durchläuft mehrere Phasen. Es existieren allerdings verschiedene Modelle, die mindestens drei und bis zu acht Phasen unterscheiden. Die Inhalte des Mediationsverfahrens sind in allen Modellen gleich. In der Praxis üblich ist ein Modell mit fünf Phasen.
Zur 1. Phase –> Auftragsklärung
Zur 2. Phase –> Themensammlung
3. Phase: Interessenfindung
Ausgehend von der aufgestellten Agenda werden alle Themen des Konflikts der Reihe nach bis zu möglichen Lösungsideen erhellt. Der Mediator bittet in Phase 3 der Mediation die Parteien um eine ausführliche Darstellung ihrer Sichtweisen zum jeweiligen Einzelthema und gibt ihnen ausreichend Zeit zum Selbstausdruck und zur Selbstreflexion. Es geht um die Ermittlung der unterhalb der Oberfläche liegenden Aspekte des Streitthemas, wobei sich der Mediator jeglicher therapeutischer Intervention zu enthalten hat.
Sich selbst und vor den anderen Beteiligten zu öffnen, fällt den Konfliktparteien dabei nicht immer leicht. Deshalb ist der Mediator bei der Gesprächsführung mit seiner ganzen mediativen Persönlichkeit unter Verwendung seines „Handwerkszeugs“ (nonverbale Kommunikation; Aktives Zuhören, lösungsorientiertes und zirkuläres Fragen, Paraphrasieren/Loopen/Spiegeln, Reframing, Doppeln, etc.) gefragt. Der Mediator unterstützt die Konfliktparteien, ihnen sichtbar zu machen, welche wichtigen Bedürfnisse, Interessen und Wünsche hinten den starren und gegensätzlichen Positionen sehen.
Die Medianten erhalten so die Gelegenheit, die Unterschiede ihrer Standpunkte in einem neuen Licht zu betrachten und von der Perspektive der anderen Streitpartei aus wahrzunehmen. Hierdurch wird gegenseitiges Verständnis und die Wieder-aufnahme direkter Kommunikation gefördert sowie die Basis für das Auffinden von Lösungsideen bereitet.
Die 4. Phase, die Optionen, werde ich in meinem nächsten Beitrag beschreiben.
Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.
Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.
Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Beratung im kollektiven Arbeitsrecht notwendig?
Falls Sie eine arbeitsrechtliche Beratung im kollektiven Arbeitsrecht benötigen, rufen Sie mich umgehend an.

Mein XING-Profil finden Sie hier. Auf LinkedIn ist mein Profi dort zu finden.

19. April 2023
Ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (kurz: BEM) muss der Arbeitgeber für Mitarbeiter anbieten, die über einen längeren Zeitraum arbeitsunfähig erkrankt sind.
Beim BEM handelt es sich nicht um ein einmaliges Gespräch, sondern um ein ergebnisoffenes Verfahren.
Dessen Ziel ist es, Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz des betroffenen Beschäftigten zu erhalten.
Die Verpflichtung des Arbeitgebers zur Durchführung eines BEM ist seit Mai 2004 im Sozialgesetzbuch IX (kurz: SGB IX) geregelt. Dennoch ist dieses Verfahren vor allem in vielen kleinen Unternehmen noch Neuland, obwohl die Durchführung in § 167 Abs. 2 SGB IX für alle privaten und öffentlichen Arbeitgeber unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten zwingend vorgeschrieben ist.
Hier finden Sie Teil 1 der Artikel-Serie.
Dort ist Teil 2 der Artikel-Serie zu finden.
4. Interne und externe Beteiligte
Nach dem Willen des Gesetzgebers sind am BEM-Verfahren neben dem betroffenen Arbeitnehmer der Arbeitgeber (ggfs. vertreten durch die Personalabteilung oder Führungskraft), der Betriebsrat und bei schwerbehinderten/gleichgestellten Beschäftigten die Schwerbehindertenvertretung beteiligt. In vielen Kleinbetrieben existiert meist keine Arbeitnehmer-/Schwerbehindertenvertretung, so dass diese Institutionen als Teilnehmer eines BEM-Prozesses wegfallen. Folglich liegt dann die Verantwortung für die Durchführung eines BEM allein beim Inhaber des Betriebs. Um als Inhaber ein BEM-Verfahren korrekt durchführen zu können, braucht es jedoch spezielle Fachkenntnisse, die bei vielen meist fehlen dürften. Der Gesetzgeber nimmt auf diese Umstände aber keine Rücksicht: ob Großkonzern oder kleine Praxis – jeder Arbeitgeber muss ein BEM-Verfahren ordnungsgemäß durchführen, sonst drohen ihm Rechtsnachteile (s. u.). Durch den im Juni 2021 eingefügten § 167 Abs. 2 Satz 2 SGB IX können Beschäftigte bei der Durchführung des BEM-Verfahrens zusätzlich eine Vertrauensperson eigener Wahl hinzuziehen. Auch der Rechtsanwalt des BEM-Berechtigten ist eine solche Vertrauensperson. Vor dieser Neuregelung war umstritten, ob Rechtsanwälte zum BEM hinzugezogen werden können. Von der Rechtsprechung wurde diese Frage verneint.
Nach § 167 Abs. 2 Satz 2 SGB IX hat der Arbeitgeber zum BEM-Verfahren gegebenenfalls den Werks- oder Betriebsarzt hinzuzuziehen. Auch hier können sich kleine Unternehmen nicht „drücken“. Denn das Arbeitssicherheitsgesetz (kurz: ASiG) schreibt vor, dass jeder Betrieb unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter über einen (externen) Betriebsarzt verfügen muss. Um diese Verpflichtung zu erfüllen, bieten viele Berufsgenossenschaften Kleinbetrieben ihre Unterstützung an. Da im Rahmen eines BEM-Verfahrens gesundheitliche Tätigkeitseinschränkungen des betroffenen Mitarbeiters erörtert werden, ist die Hinzuziehung eines Arbeitsmediziners in der Person des Betriebsarztes oft unumgänglich.
Als externe Beteiligte eines BEM-Prozesses kommen das Integrationsamt, der Integrationsfachdienst, die Krankenkasse, der Medizinische Dienst der Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die Berufsgenossenschaft, die Agentur für Arbeit, Fachärzte sowie Reha-Kliniken in Frage. Diese externen Stellen können ihre speziellen Leistungen zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit, zur ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung, zur beruflichen Qualifizierung und zur Gewährleistung des Unfallschutzes und der Arbeitssicherheit in den BEM-Prozess einbringen. Ihre Beteiligung empfiehlt sich aber erst dann, wenn die innerbetrieblichen BEM-Gespräche konkret nahelegen, zu prüfen, ob Maßnahmen externer Stellen sinnvoll erscheinen.
Viele Krankenkassen verfügen über speziell ausgebildete Mitarbeiter, die als BEM-Koordinatoren Unternehmen bei der Durchführung eines BEM-Verfahrens unterstützen. Gerade für Kleinbetriebe stellt dies eine wertvolle Hilfe dar.
Der Beitrag wird hier fortgesetzt mit Teil 4.
Podcast Arbeitsrecht

In unserem Podcast Arbeitsrecht wollen mein Kollege Jürgen Sauerborn und ich unterhaltsam, kurzweilig und in leicht verständlicher Sprache über Wichtiges und Neues aus dem Arbeitsrecht und dem angrenzenden Sozialrecht informieren.
Monatlicher Newsletter

In meinem monatlich erscheinenden Newsletter berichte ich über Wissenswertes und Kurioses aus den Bereichen Arbeitsrecht, Mediation, Betriebliches Eingliederungsmangement, Coaching und aus meinem beruflichen Alltag.
Werden auch Sie Abonnent! Ganz unverbindlich und kostenlos…

Beratung im kollektiven Arbeitsrecht notwendig?
Falls Sie eine arbeitsrechtliche Beratung im kollektiven Arbeitsrecht benötigen, rufen Sie mich umgehend an.

Mein XING-Profil finden Sie hier. Auf LinkedIn ist mein Profi dort zu finden.